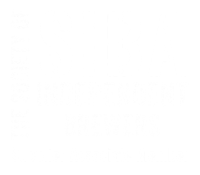-
AEB
- AEB
-
Über
- Über
-
Gruppe
- Gruppe
-
Info & Kontakte
- Info & Kontakte
-
Nachhaltige innovationen
- Nachhaltige innovationen
-
ÖNOLOGIE
- ÖNOLOGIE
-
- Biotechnologie
-
- Anlagen und Geräte
-
- Filtration
-
BIER
- BIER
-
- Biotechnologie
-
- Anlagen und Geräte
-
- Filtration
-
FOOD
- FOOD
-
- Anlagen und Geräte
-
- Filtration
-
AEB NEXT
- AEB NEXT
-
- HARD SELTZER
-
- ENTALKOHOLISIERTER WEIN
-
- APFELWEIN
-
Nachhaltige innovationen
- Nachhaltige innovationen
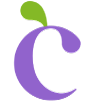
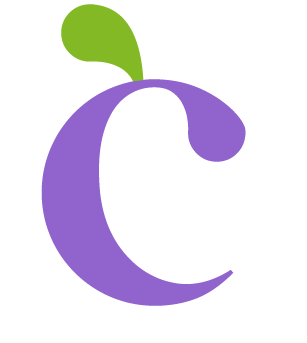 CIDER
CIDER